web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Militärluftfahrtmuseum Zeltweg
Hangar 8 Fliegerhorst Hinterstoisser, August 2024
Im alten historischen Hangar 8 werden auf 5.000 m² Ausstellungsfläche über 25 Luftfahrzeuge aus der Geschichte der österreichischen Militärluftfahrt - schwerpunktmäßig jene des Bundesheeres der 2. Republik - gezeigt. Unter den ausgestellten Luftfahrzeugen befinden sich unter anderem eine Yakovlev Yak-18, das erste beim Österreichischen Bundesheer der 2. Republik in Dienst gestellte Flugzeug, und weitere für die Geschichte der Luftstreitkräfte bedeutende Typen wie die Fouga CM 170 »Magister«, die De Havilland DH-115 »Vampire«, die Saab J-29F »Fliegende Tonne« und der Hubschrauber Agusta Bell 204 sowie der bekannte Saab 350E »Draken«.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bundesheeres der Zweiten
Republik entschloss sich das Kommando der Luftstreitkräfte 2005 zur
Gestaltung einer temporär begrenzten Militärluftfahrtausstellung. Die
Sammlung blieb weiter bestehen; seit dem Jahr 2012 wird das nunmehrige
Militärluftfahrtmuseum Zeltweg als Außenstelle des
Heeresgeschichtlichen Museums HGM in Wien geführt.

Neben Flächenflugzeugen und Hubschraubern kann der luftfahrtbegeisterte
Besucher einen Simulator, Flugzeugmotore, Strahltriebwerke,
Fliegerabwehrkanonen, Radargeräte, fliegertechnische Geräte, Uniformen
und Ausrüstungsgegenstände der Luftstreitkräfte, zahlreiche Schautafeln
und Fotografien sowie Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen der
österreichischen Militärluftfahrt besichtigen.

Mehrzweckhubschrauber Sud Aviation SA 316B Alouette III
Hersteller: Sud Aviation, Frankreich
Baujahr: 1967
Triebwerk: Turboméca Artouste III B1
Leistung: 570 Wellen-PS (425 kW)
Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 210 km/h
Dienstgipfelhöhe: 3.250 m
Maximales Startgewicht: 2.200 kg
Rumpflänge: 10,11 m
Hauptrotordurchmesser: 10,93 m
Höhe: 3,09 m
Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 7
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1967 bis dato
Stückzahl: 29
Verwendung: Transportflüge, Verbindungsflüge, Rettungs- und Bergeflüge
Der französische Mehrzweckhubschrauber Alouette III ging bereits 1961
in Serienproduktion. Da die Österreichischen Luftstreitkräfte schon
gute Erfahrungen mit dem Vorgängermodell Alouette II gemacht hatten,
wurden ab 1967 die ersten Alouette III beschafft. Die Maschinen sind
immer noch im Einsatz, sie werden voraussichtlich 2023 ersetzt.

Schulflugzeug Yakovlev Yak-18
Hersteller: OKB-115 Yakovlev, Sowjetunion
Baujahr: 1950
Triebwerk: Shvetsov M-11 FR
Leistung: 160 PS (118 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 248 km/h
Dienstgipfelhöhe: 3.000 m
Maximales Startgewicht: 1.120 kg
Länge: 8,07 m
Flügelspannweite: 10,60 m
Höhe: 3,10 m
Flügelfläche: 17,00 m²
Besatzung: 1-2
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1955-1960
Stückzahl: 4
Verwendung: Fortgeschrittenen-Schulung für Piloten Überwachungsgeschwader,
Restauriert von: 1. Fliegertechnische Kompanie, Zeltweg
Die Yakovlev Yak-18 war das erste Militärflugzeug der Zweiten Republik,
also der Bundesrepublik Österreich nach 1945. Der Erstflug fand am 9.
Dezember 1955 statt. Zum Einsatz kamen die Yak-18 als Schulflugzeuge
für jene österreichischen Piloten, die im Zweiten Weltkrieg schon in
der deutschen Luftwaffe gedient hatten.

Mehrzweckhubschrauber Sud-Est SE 3130 Alouette II
Hersteller: Sud Aviation, Frankreich
Baujahr: 1964
Triebwerk: Turboméca Artouste II В6
Leistung: 406 Wellen-PS (298 kW)
Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 175 km/h
Dienstgipfelhöhe: 4.000 m
Maximales Startgewicht: 1.600 kg
Rumpflänge: 9,60 m
Hauptrotordurchmesser: 10,20 m
Höhe: 2,75 m
Besatzung / Passagiere: 1-2/ bis zu 3
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1958-1975
Stückzahl: 16
Verwendung: Ausbildung von Hubschrauberpiloten, Verbindungsflüge, Rettungs- und Bergeflüge
Restauriert von: Fliegerwerft A, Aigen im Ennstal
Die Alouette II war Ende der 1950er Jahre der modernste Hubschrauber in
seiner Klasse und wurde weltweit militärisch genutzt. In Österreich
1958 eingeführt, erwiesen sich die Maschinen schnell als robust und
leistungsstark, also ideal für den Einsatz im Gebirge. 1975 wurden die
letzten österreichischen Alouette II verkauft, die hier ausgestellte
Maschine stammt von den Heeresfliegerkräften der Deutschen Bundeswehr.

Schulflugzeug Let C-11
Hersteller: LET Kunovice, Tschechoslowakei
Baujahr: 1955
Triebwerk: Shvetsov ASh-21
Leistung: 700 PS (515 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 475 km/h
Dienstgipfelhöhe: 7.500 m
Maximales Startgewicht: 2.450 kg
Länge: 8,50 m
Flügelspannweite: 9,40 m
Höhe: 3,18 m
Flügelfläche: 15,40 m²
Besatzung: 1-2
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1956-1965
Stückzahl: 4
Verwendung: Schulflugzeug für Jagdpiloten, Zielschleppflugzeug, Aufklärung, Einsatzflugzeug
Restauriert von: Fliegerwerft 2, 2. Fachabteilung, Graz-Thalerhof
Die Let C-11 ist eine tschechoslowakische Lizenzversion des
sowjetischen Flugzeugtyps Yakovlev Yak-11. 1955 erhielt die Republik
Österreich vier Maschinen als Geschenk von der Sowjetunion.

Mehrzweckhubschrauber Agusta Bell AB-206A JetRanger
Hersteller: Agusta S.p.A., Italien
Baujahr: 1969
Triebwerk: Allison 259-C18
Leistung: 317 Wellen-PS (230 kW)
Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 230 km/h
Dienstgipfelhöhe: 6.100 m
Maximales Startgewicht: 1.360 kg
Rumpflänge: 8,74 m
Hauptrotordurchmesser: 10,16 m
Höhe: 2,95 m
Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 4
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1969-2009
Stückzahl: 13
Verwendung: Grundschulung von Hubschrauberpiloten, Verbindungsflüge
Der Agusta Bell AB-206A JetRanger ist die italienische Lizenzversion
des gleichnamigen Modells der US-amerikanischen Firma Bell Helicopter
Company. Die AB-206A der Österreichischen Luftstreitkräfte wurden 2009
außer Dienst gestellt und bis auf die hier ausgestellte Maschine alle
verkauft.

Cessna L-19 „Bird Dog"
Im Einsatz: 1958/59-1997
Herstellerfirma: Cessna, USA
Stückzahl: 22/7
Abmessungen Länge: 7,87 m
Spannweite: 10,97 m
Höhe: 2,79 m
Flügelfläche: 16,16 m²
Max. Startgewicht: 985/1.090 kg
Triebwerk: Continental O-470-11, 213 PS
Bewaffnung: keine
Max. Geschwindigkeit: 208 km/h
Dienstgipfelhöhe: 6.980 m
Leihgabe: Heeresgeschichtliches Museum
Verwendung: Schulflugzeug, Aufklärungsflugzeug (Luftbild), Verbindungsflugzeug
Restauriert: Fliegerwerft 3, HÖRSCHING
Die Cessna L-19 „Bird Dog" ist ein zweisitziges Mehrzweckflugzeug mit
einem 213 PS Kolbenmotor und wurde als Verbindungs-, Aufklärungs- und
Schulungsflugzeug genutzt. Diese Maschine wurde in vielen Streitkräften
in Europa und Asien (Frankreich, Türkei, Thailand, Vietnam, usw.)
geflogen. Die Cessna L-19 „Bird Dog" wurde ab 1958 im Rahmen des
„Military Assistance Program" an Österreich geliefert. Insgesamt 29
Maschinen der Versionen A und E waren zwischen 1958 und 1997 bei den
Österreichischen Luftstreitkräften im Einsatz. Das Aufgabenspektrum
reichte von Verband- und Instrumentenflugschulung bis hin zu
Luftbildeinsätzen und Artilleriebeobachtung. Ab 1967 wurden neun
Maschinen an die Flugsportgruppe „Rot- Weiß-Rot" abgegeben, die noch
übrigen sechs Maschinen kamen 1986 zurück zu den Luftstreitkräften.
1997 schied man die L-19 endgültig aus und versteigerte acht Maschinen
im Dorotheum. Die meisten gingen nach Übersee und wurden dort weiter
geflogen.

Mehrzweckhubschrauber Agusta Bell AB-204B
Hersteller: Agusta S.p.A., Italien
Baujahr: 1967
Triebwerk: Bristol Siddeley Gnome Mk.610
Leistung: 1.200 Wellen-PS (882 kW)
Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 216 km/h
Dienstgipfelhöhe: 4.000 m
Maximales Startgewicht: 4.310 kg
Rumpflänge: 12,31 m
Hauptrotordurchmesser: 14,63 m
Höhe: 3,87 m
Besatzung / Passagiere: 2-3/bis zu 9
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1963-2001
Stückzahl: 26
Verwendung: Transportflüge, Rettungs- und Bergeflüge, Einsatz von luftbeweglichen Truppen, Absetzen von Fallschirmspringern
Restauriert von: Fliegerwerft 3, Hörsching
Die hier ausgestellte Maschine absolvierte im Juli 2001 ihren Abschiedsflug.

Triebwerk der De Havilland DH-115
„Vampire" T-55
Type: D.H. Goblin 35
Einstufiger Radialverdichter
16 Brennkammern
Leistung: 15,8 KN Schub

Schulflugzeug Fiat G.46-4B
Hersteller: Fiat S.p.A., Italien
Baujahr: 1950
Triebwerk: Alfa Romeo 115ter
Leistung: 225 PS (168 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 312 km/h
Dienstgipfelhöhe: 5.400 m
Maximales Startgewicht: 1.110 kg
Länge: 8,50 m
Flügelspannweite: 10,40 m
Höhe: 2,40 m
Flügelfläche: 16,00 m²
Besatzung: 1-2
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1957-1963
Stückzahl: 5
Verwendung: Verbandflugausbildung
Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg
Der einmotorige Tiefdecker Fiat G.46 wurde ab 1949 in Italien erzeugt.
1957 schenkte die Republik Italien den neu gegründeten Österreichischen
Luftstreitkräften fünf Maschinen der Version G.46-4B. Die hier
ausgestellte Maschine diente bis 2004 als „Gate Guard" beim Haupttor
des Fliegerhorstes in Zeltweg. Von diesem Flugzeugtyp existieren
weltweit nur mehr zwei Stück.

Saab 350E „Draken"
Im Einsatz: 1987-2005
Herstellerfirma: Saab, Schweden
Stückzahl: 24
Abmessungen Länge: 15,33 m
Spannweite: 9,40 m
Höhe: 3,89 m
Tragfläche: 49,20 m²
Einsatzart: Abfangjäger/Luftraumüberwachungsflugzeug
Max. Startgewicht: 11.864 kg
Triebwerk: Svenska Flygmotor RM 6C
Bewaffnung: 2 Kanonen 30 mm ADEN M55, 2 AIM-9P3/9P5 "Sidewinder" Luft-Luft-Lenkwaffen
Max. Geschwindigkeit: 2.150 km/h
Dienstgipfelhöhe: 18.700 m
Leihgabe: Heeresgeschichtliches Museum
Der Saab 35 OE „Draken" ist ein Überschall-Abfangjäger der 2.
Generation. Das einsitzige Kampfflugzeug hat Doppeldeltaflügel, ein
Triebwerk und ist mit zwei 30-mm-Maschinenkanonen „ADEN M55" und
Luft-Luft-Lenkwaffen vom Typ AIM-9P3/9P5 „Sidewinder" ausgerüstet. Als
Teil des österreichischen Luftraumüberwachungssystems wurden die Draken
neben der Wahrung der Lufthoheit vor allem für luftpolizeiliche
Kontrollaufgaben herangezogen.

Schulflugzeug North American LT-6G Texan
Hersteller: North American Aviation, USA
Baujahr: 1949
Triebwerk: Pratt & Whitney R-1340
Leistung: 600 PS (440 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 341 km/h
Dienstgipfelhöhe: 6.050 m
Maximales Startgewicht: 2.523 kg
Länge: 8,99 m
Flügelspannweite: 12,81 m
Höhe: 3,57 m
Flügelfläche: 23,57 m²
Besatzung: 1-2
Bewaffnung: 2 x 7,62 mm M1919A4 Maschinengewehre
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1959-1968
Stückzahl: 10
Verwendung: Verband- und Instrumentenflugschulung
Restauriert von: Fliegerwerft 1, Langenlebarn
Die North American T-6 Texan ist eines der meistgebauten Schulflugzeuge
der Welt und wird auch heute noch gerne zivil geflogen. Im Rahmen des
Military Assistance Program der USA erhielten die Österreichischen
Luftstreitkräfte 1959/60 insgesamt zehn Maschinen der Version LT-6G.
Die hier ausgestellte Maschine ist die einzig erhaltene LT-6G Texan
dieser Lieferung.


Schulflugzeug Zlín Z-126 Trenér II
Hersteller: Moravan n.p., Tschechoslowakei
Baujahr: 1955
Triebwerk: Walter Minor 4-III
Leistung: 105 PS (77 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h
Dienstgipfelhöhe: 4.750 m
Maximales Startgewicht: 765 kg
Länge: 7,56 m
Flügelspannweite: 10,28 m
Höhe: 2,10 m
Flügelfläche: 14,90 m²
Besatzung: 1-2
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1957-1965
Stückzahl: 4
Verwendung: Grund- und Fortgeschrittenenschulung
Restauriert von: Bundesfachschule für Flugtechnik, Langenlebarn
Die hier ausgestellte Maschine war in Zeltweg stationiert und befand
sich am 6. Dezember 1962 auf einem Übungsflug für Gefahreneinweisung
als es zu einem Motorschaden kam. Bei der folgenden Notlandung blieben
Fluglehrer Franz Gutmann und Flugschüler Franz Lichtenegger unverletzt,
das schwer beschädigte Flugzeug wurde jedoch nicht wieder aufgebaut.
Das Wrack kam in Privatbesitz und kehrte 2008 vollständig restauriert
wieder zurück nach Zeltweg und befindet sich seitdem hier im Museum.


RM6C (Draken)
Gewicht: 1 400 kg (ohne Nachbrenner), 1 780 kg (mit Nachbrenner)
Schub: 55 KN ohne Nachbrenner oder 76 KN mit Nachbrenner
Drehzahl: 8 000 min ^-1 maximal
TL: Turbo - Lufstrahl - Triebwerk (Einwellentriebwerk) (RR AVON wurde bei VOLVO auf Lizenz gebaut)

Schulflugzeug Saab 91D Safir
Hersteller: Saab, Schweden
Baujahr: 1964
Triebwerk: Lycoming O-360-A1A
Leistung: 180 PS (132 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 265 km/h
Dienstgipfelhöhe: 5.000 m
Maximale Abflugmasse: 1.205 kg
Länge: 8,03 m
Flügelspannweite: 10,60 m
Höhe: 2,20 m
Flügelfläche: 13,60 m²
Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 2
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1964-1997
Stückzahl: 24
Verwendung: Grund- und Fortgeschrittenenschulung, Verbindungsflüge
Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg
Die Saab 91D Safir ist ein viersitziger Tiefdecker. Ihre Einführung
1964 war der erste Schritt zu einer einheitlichen
Flugzeugführerausbildung bei den Österreichischen Luftstreitkräften.

Jagdflugzeug Saab J 29F Tunnan
Hersteller: Saab, Schweden
Baujahr: 1954
Triebwerk: Svenska Flygmotor RM 2B
Leistung: 21,1 kN Schub
Höchstgeschwindigkeit: 1.060 km/h
Dienstgipfelhöhe: 15.500 m
Maximales Startgewicht: 8.375 kg
Länge: 10,20 m
Flügelspannweite: 11,00 m
Höhe: 3,75 m
Flügelfläche: 24,00 m²
Besatzung: 1
Bewaffnung: 4 x 20 mm Akan m/47C Maschinenkanonen 800 kg Waffenzuladung an acht Außenlaststationen
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1961-1972
Stückzahl: 30
Verwendung: Abfangjäger, Jagdbomber, Aufklärung
Restauriert von: Überwachungsgeschwader, 2. Fliegertechnische Kompanie, Graz-Thalerhof
Die Saab 29 Tunnan war weltweit eines der ersten Jagdflugzeuge mit
Pfeilflügeln. Ab 1961 kaufte die Republik Österreich gebrauchte J 29F
von der Schwedischen Luftwaffe.

Düsenschulflugzeug Potez/Fouga CM.170R Magister
Hersteller: Potez Air-Fouga, Frankreich
Baujahr: 1962
Triebwerk: 2 x Turboméca Marboré II A
Leistung: 2 x 3,9 kN Schub
Höchstgeschwindigkeit: 715 km/h
Dienstgipfelhöhe: 11.000 m
Maximale Abflugmasse: 3.200 kg
Länge: 10,06 m
Flügelspannweite: 12,15 m
Höhe: 2,80 m
Flügelfläche: 17,30 m²
Besatzung: 2
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1959-1972
Stückzahl: 18
Verwendung: Düsen-Grundschulung, Kunstflug
Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg
Die CM.170 Magister war in den 1950er und 1960er Jahren bei
verschiedenen Luftwaffen in Europa weit verbreitet. Nach ihrem
Ausscheiden aus den Österreichischen Luftstreitkräften 1972 wurde die
hier ausgestellte Maschine an das Irish Air Corps verkauft. Dort war
sie bis 1999 im Einsatz und kam schließlich als Geschenk wieder zurück
in das Luftfahrtmuseum Zeltweg.

Düsenschulflugzeug de Havilland DH.115 Vampire T.11
Hersteller: de Havilland Aircraft Company, Großbritannien
Baujahr: 1955
Triebwerk: de Havilland Goblin 35B
Leistung: 15,6 kN Schub
Höchstgeschwindigkeit: 833 km/h
Dienstgipfelhöhe: 12.200 m
Maximales Startgewicht: 6.200 kg
Länge: 10,51 m
Flügelspannweite: 11,59 m
Höhe: 2,23 m
Flügelfläche: 24,34 m²
Besatzung: 1-2
Bewaffnung: 4 x 20 mm Hispano Mk.V Maschinenkanonen, 500 kg Waffenzuladung an Außenlaststationen
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1957-1972
Stückzahl: 9
Verwendung: Düsen-Grundschulung, Jagdbomber
Restauriert von: Fliegerregiment 3, Hörsching
Die de Havilland DH.115 Vampire war das erste Düsenflugzeug der
Österreichischen Luftstreitkräfte. Die hier ausgestellte Maschine stand
nach ihrer Ausscheidung 1972 viele Jahre vor einer Schule in Linz,
bevor sie aufwändig restauriert und ins Luftfahrtmuseum gebracht wurde.

Transportflugzeug Short SC.7 Skyvan SRS 3M
Hersteller: Short Brothers, Nordirland
Baujahr: 1969
Triebwerk: 2 x Garrett TPE 331-2-201A
Leistung: 2 x 715 Wellen-PS (2 x 533 kW)
Höchstgeschwindigkeit: 402 km/h
Dienstgipfelhöhe: 6.705 m
Maximale Abflugmasse: 6.214 kg
Länge: 12,21 m
Flügelspannweite: 19,79 m
Höhe: 4,60 m
Flügelfläche: 35,12 m²
Besatzung / Passagiere: 1-3/bis zu 19
Bewaffnung: keine
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1969-2007
Stückzahl: 2
Verwendung: Transportflüge, Absetzen von Fallschirmspringern
Das leichte Transportflugzeug Short SC.7 Skyvan ist wegen seines
quadratischen Rumpfquerschnitts und der Heckrampe gut geeignet für das
Verladen von sperrigen Frachten sowie den Transport von Truppen oder
Fallschirmspringern. Der Schulterdecker mit relativ großen Tragflächen
besitzt hervorragende Kurzstart- und Kurzlandeeigenschaften auch auf
unbefestigten Flächen.

Mehrzweckflugzeug Saab 1050Е
Hersteller: Saab, Schweden
Baujahr: 1971
Triebwerk: 2 x General Electric J85-GE-17B
Leistung: 2 x 12,7 kN Schub
Höchstgeschwindigkeit: 970 km/h
Dienstgipfelhöhe: 13.200 m
Maximales Startgewicht: 6.500 kg
Länge: 10,50 m
Flügelspannweite: 9,50 m
Höhe: 2,80 m
Flügelfläche: 16,30 m²
Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 3
Bewaffnung: 2 x 30 mm ADEN Mk.4 Maschinenkanonen (extern) oder bis zu 12 ungelenkte 75 mm Raketen
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1970 bis 2020
Stückzahl: 40
Verwendung: Düsenschulflugzeug, Erdkampfflugzeug, Aufklärung, Passagierflugzeug
Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg
Die Saab 1050E ist eine Exportversion der schwedischen Saab 105XT. Die
hier ausgestellte Maschine wurde nach Ablauf ihrer Lufttüchtigkeit im
April 2014 dem Luftfahrtmuseum Zeltweg übergeben.

Cessna L-19 „Bird Dog"

Abfangjäger Saab J 350E Draken „Dragon Knight"
Hersteller: Saab, Schweden
Baujahr: 1968
Triebwerk: Svenska Flygmotor RM 6C
Leistung: 57 kN Schub
Höchstgeschwindigkeit: 2.150 km/h
Dienstgipfelhöhe: 18.700 m
Maximales Startgewicht: 11.864 kg
Länge: 15,35 m
Flügelspannweite: 9,40 m
Höhe: 3,89 m
Flügelfläche: 49,20 m²
Besatzung: 1
Bewaffnung: 2 x 30 mm ADEN m/55 Maschinenkanonen 2 x AIM-9P3/9P5 Sidewinder Luft-Luft-Lenkwaffen
Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften
Einsatzzeitraum: 1987-2005
Stückzahl: 24
Verwendung: Abfangjäger, Luftüberwachung
Der Saab J 350E Draken ist ein Überschall-Abfangjäger der 2.
Generation. Die 24 österreichischen J 350E wurden gebraucht von der
Schwedischen Luftwaffe beschafft. Die hier ausgestellte Maschine wurde
2005 anlässlich des 45-jährigen Dienstjubiläums sowie des letzten
Fluges („Fly-Out") eines Draken vom Überwachungsgeschwader in Zeltweg
mit der „Dragon Knight"-Sonderlackierung versehen.


Tiger, Tiger, Tiger!
Der Tiger als Symbol und Zeichen für Kraft, Schnelligkeit und Jagdtrieb
ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Wappentiere der
Militärpiloten. Dies ist und war auch in Österreich nicht anders, der
Weg der heutigen Tiger-Staffel bis zum „Full Member" der „NATO Tiger
Association" war allerdings ein langer. Als Anfang der 1960er Jahre das
erste „Tiger Meet" stattfand, spielten in den Österreichischen
Luftstreitkräften Staffelabzeichen als Identitäts- und
Zusammengehörigkeitsmerkmal noch keine Rolle, im Gegenteil, sie waren
nicht wirklich erwünscht. Die jungen Piloten waren aber da ganz anderer
Meinung. So entschied 1966/67 der Kommandant der 1. JaBo-Staffel, die
Einheit brauche ein entsprechendes Abzeichen. Beeinflusst von
Kameraden, die in den USA ihre Pilotenausbildung gemacht hatten, und
animiert vom Tiger-Logo des Öl-Konzerns ESSO („Pack den Tiger in den
Tank") entschied man sich für einen freundlich blickenden Tiger mit
einer Rakete in der Pranke als Abzeichen. Die „Tiger-Staffel" war
geboren. Die 1. JaBo-Staffel hatte eigentlich den Steinbock des
schwedischen Geschwaders F 15 als Wappen auf den 15 Saab J-29F, für die
Staffel war aber der Tiger ihr Symbol. Dies änderte sich auch mit der
Einführung der Saab 1050E ab 1970 nicht, vorerst blieb es nur beim
Tiger-Abzeichen auf dem Flugdienstanzug. Mitte der 1970er Jahre
wandelte sich die Situation: Österreichs Luftstreitkräfte waren mit
einem Kunstflugschwarm (1975/76 „Silver Birds", ab 1976 „Karo As") und
einem Solo-Piloten (gestellt vom JaBo-Geschwader) gern gesehene Gäste
bei Flugtagen in ganz Europa. Insbesondere in den Jahren 1976-1979 war
der Tiger als Abzeichen des „Solo-Display"-Piloten oft zu sehen, dazu
kam 1978 der erste „Tiger-Helm", noch händisch mit Folie beklebt.
Anfang der 1980er Jahre zeigte sich der Tiger dann erstmals auf den
Maschinen der 1. Staffel/JaBo-Geschwader. Inzwischen trugen auch die
Piloten der 2. Staffel (Aufklärung) einen Tiger mit einem Feldstecher
„bewaffnet" auf ihren Kombis. Die Saab 105 der Staffel erhielten aber
nie ein derartiges Abzeichen.
1993 gelang es dem JaBo-Geschwader, die Genehmigung für eine
Sonderlackierung im „Tiger-Look" zu erreichen. Die „YA-01" flog am 23.
September 1993 erstmals in einem von den Piloten entworfenen und auch
lackierten Anstrich. Dies war durchaus eine Sensation, denn die
international so beliebte Tradition von Sonderbemalungen fand in der
österreichischen Ministerialbürokratie kaum Unterstützung. Das Vorhaben
gelang primär mit Hilfe ehemaliger Geschwaderangehöriger, die
inzwischen in höhere Stäbe abgewandert waren. Der ersten „Tiger-105"
war aber nur ein kurzes Dasein beschert, die Maschine wurde im März
1995 bei einem Absturz zerstört. Als Ersatz startete noch im Sommer
1995 die „GF-16" in leicht geändertem Design zum Erstflug. Mit dem
„zweiten Tiger", der bis Sommer 2010 als Display-Maschine im Dienst
stand und der Aufstellung der 3. Staffel, die von Anfang an die
Tiger-Idee hochhielt, begann die eigentliche Geschichte der
„Tigerstaffel". Außerliches Zeichen war ein neues „Patch" auf dem
Flugdienstanzug und auch auf den Maschinen, das offizielle
Staffelabzeichen zeigte vorerst allerdings noch keinen Tiger.

Luftraumüberwachung - Kurzwellenfunkgerät
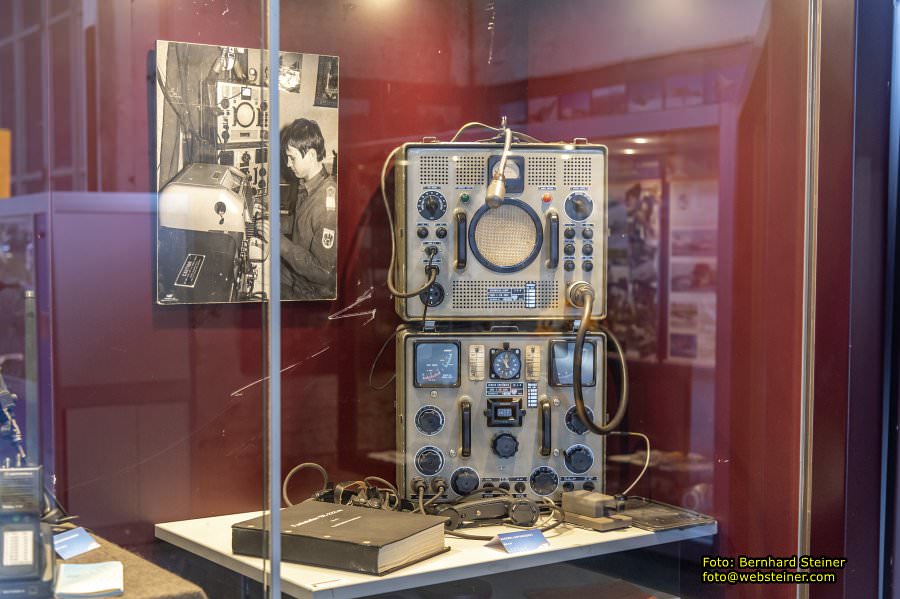
Uniformen und Sonderbekleidung

Sonderausstellungen

"Der Volksjäger - Entwicklung und Produktion der Heinkel 162 in Österreich"
Der Volksjäger war „Wunderwaffe" - das erste Strahlflugzeug mit einer
Turbine und mit einem Schleudersitz - und Wegwerfprodukt" zugleich. In
dieser Ausstellung wird die He 162 nicht nur als rein technisches Gerät
dargestellt. Um dieses Projekt „Gewaltaktion 162" zu verstehen, muss
man sowohl Technik, als auch NS-Geschichte betrachten. Es verdeutlicht
wie kaum ein anderes Luftfahrzeug des Dritten Reiches die
menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus: 1944 in wenigen
Wochen entwickelt, und überwiegend von KZ-Häftlingen gefertigt, sollte
die unausgereifte, schwer zu steuernde Maschine von Hitlerjungen, die
nur auf Segelflugzeugen geschult waren, in den Fronteinsatz geschickt
werden.

Der „Jägerstab": Die statistische Illusion
Im Februar 1943 hatte Galland, der General dor Jagdfileger, Hitler auf
die Gefahr einer erweiterten Reichweite der amerikanischen Begleitjäger
hingewiesen. Hitler antwortete, dass sich die Frage von feindlichen
Jagdmaschinen über dem Reichsgebiet nicht stelle, da ihm Göring
versichert habe, dass es technisch nicht möglich sei, derartige
Jagdmaschinen zu bauen. Sechs Monate spater meldete Galland dem Führer
das Auftauchen amerikanischer Begleitjäger bei Aachen und wies erneut
auf die schwerwiegenden Folgen für die deutsche Tagjagd hin, sollten
die Amerikaner - was durchaus realistisch war - noch höhere
Einsatzreichweiten erzielen. Darauf wurde er von Göring aur Rede
gestellt, der diese Meldung als Phantasterei und Schwindel bezeichnete.
Als Galland darauf beharrte, erteilte thm Göring den Befehl, dass es
keine amerikaniachen Jäger bei Aschen gegeben habe. Für Göring erschien
eine erweiterte Eindringtiefe der alliierten Jäger nicht diskutabel,
und auch Hitler hatte sie ja zurückgewiesen. Derartige Fälle von
Realitätsverlust änderten aber nichts an den sachlichen Gegebenheiten.
Die „Bomber-Jäger-Kontroverse" war ja schon lange ein ständiger
Streitpunkt. Der langwierige Entscheidungsprozess bezüglich der Frage
einer Rüstungsverschiebung in Richtung Luftverteidigung lief zwischen
1942 und 1944 in mehreren Phasen ab. Eine gemeinsame Linie zwischen
Generalluftzeugmeister Milch als Verantwortlichen für die Luftrüstung
und den Generalstabschefs Jeschonnek, Korter und Kreipe war kaum zu
finden, primär mußten Göring und in letzter Instang Hitler überzeugt
werden. Milch drängte schon früh auf eine erhöhte Jägerproduktion,
konnte sich aber gegen den Generalstab, Göring und Hitler kaum
durchsetzen. Es gelang ihm aber dennoch die Anzahl der Jagdflugzeuge
langsam, aber kontinuierlich zu erhöhen. Die im Frühsommer 1943
begonnene angloamerikanische „Pointblank"-Luftoffensive mit dem
strategischen Ziel, die Luftherrachaft für die geplante Landung in
Westeuropa zu erreichen, zwang die deutsche Führung in Richtung
Defensive. Ab diesem Zeitpunkt operierte bereits die Mehrzahl der
deutschen Jagdverbände zur Abwehr alliierter Bombenangriffe auf dem
westlichen Kriegsschauplatz. Die bisherigen Produktionszahlen für
Jagdflugzeuge reichten nicht aus. Eine weitestgehende Umverteilung der
Ressourcen innerhalb der Luftrüstung war erforderlich, denn der Aufwand
für die Herstellung eines Jagdflugzeuges lag im Verhältnis zu dem eines
zweimotorigen mittleren Bombers bei ca. 1:4, und bei einem schweren
viermotorigen Bomber bei 1:10. Die Verteidigung der Rüstungsindustrie
und der Schutz der Städte bedurfte aber vor allem vieler Jagdflugzeuge.
In der sogenannten „Big Week" im Februar 1944 flogen die beiden
strategiachen U.S.-Luftflotten 26 schwere Angriffe gegen die deutsche
Flugzeugindustrie, trafen die Luftrüstung schwer, verzögerten ihren
Ausbau um ein bis zwei Monate und vernichteten zudem mehrere hundert
fertige auf die Überführung zu den Verbänden wartende Flugzeuge.
Außerdem nahmen die Verluste des Reichsverteidigung derartige Ausmaße
an, dass nun auch Hitler und Göring einer Verschiebung der offensiven.
zur defensiven Luftkriegsführung, and somit der massiven
Produktionserhöhung bei den Jagdflugzeugen zustimmten.
Nach der „Big Week" war klar, dass die Flugzeugindustrie nur in einem
gemeinsamen Kraftakt zwischen der Luftwaffe unter dem für die Rüstung
zuständigen Generalluftzeugmeister Milch und dem Rüstungsministerium
unter Minister Speer weiter existieren konnte.
Ein rascher Wiederaufbau, eine weitere Steigerung der Produktion und
eine beschleunigte Dislozierung der einzelnen Werke und Lieferanten war
für Milch ohne die politischen Vollmachten und Ressourcen des
Ministeriums Speer aussichtslos, sodass eine Eingliederung der gesamten
Luftrüstung in das Ministerium Speer als die optimale Lösung erschien.
Am 1. März 1944 nahm der sogenannte „Jagerstab" offiziell Gestalt an.
Auch Hitler stimmte zu und gewährte die geforderten weitgehenden
Verfügungsbefugnisse mit dem Ziel der Erhöhung und bombensicheren
Auslagerung der Jagdflugzeugproduktion. Der Jägerstab kontrollierte die
Leistungen der Werke, für die Schadensbehebung nach Bombardements
wurden mobile Aufräum- und Reparaturkommandos aufgestellt, die
unmittelbar nach den Angriffen vor Ort mit der Wiederherstellung
beginnen konnten. Gleichzeitig wurde auch die Verlagerung und
Dislozierung der Luftrüstung vorangetrieben. Die Führung übernahm von
Anfang an Speers Mitarbeiter Karl-Otto Saur, der sich sehr schnell
durch regelmäßige direkte Kontakte zu Hitler von Einflüssen Speers,
Milchs aber auch Görings nahezu vollkommen entziehen konnte und über
eine große Machtfülle verfügte. Der rasche Wiederaufbau und die
Steigerung der Produktion wurde, neben den organisatorischen Maßnahmen
vor Ort, maßgeblich aber erst durch die Einführung des
72-Stunden-Woche, dem verstärkten Einsatz von Zwangsarbeitern und
Sonderzuteilungen an Lebensmitteln und Bekleidung erreicht.
Die mit Gründung des „Jagerstabs" de facto vollzogane Schwerpunktlegung
auf die Luftverteidigung wurde nach der Landung der Allierten auch de
Jure durch Hitlers Order nachtraglich entschieden: „Es kommt is unserer
Lage darauf an, Jäger und nochmals Jäger bauen." Ende Juni 1944 belahl
Göring trotz immer nach vorhandenen Widerstands der „Bomber-Fraktion"
in Generalstab die völlige Einstellung der Produktion von Bombern und
Transportern zugunsten von Jagd- und Strahlflugzeugen. Die Erhöhung der
Produktion gelang, trotz der alliierten Luftangriffe hatte man his zum
September 1944 einen monatlichen Ausstoß von über 3.000 einsitzigen
Jagdhugzeugen erreicht. Das war zweifelsohne nicht dem Jägerstab
alleine zuzuschreiben, sondern auch durch das vorangegangene Wirken das
rüstungsverantwortlichen Generailuftzeugmeisters möglich geworden.
Das „Rustungswunder" blieb aber eine „statistische Illusion", denn das
Vorhandensein fabriksneuer Flugzeuge bedeutete ja noch lange keine
Erhöhung der Kampfkraft: die Anzahl war durch die massiven Verluste und
in Anbetracht der angloamerikanischen Massenproduktion immer noch zu
gering. Die Bereitstellung der Werkstoffe (Aluminium, Gummi...) wurde
immer schwieriger. Die nach der „Big Week" begonnene Zerstörung der
Treibstoffproduktion und der Transportinfrastruktur beschränkten die
Ausbildung der Piloten, die Zuführung zur Truppe und auch den
Einsatzbetrieb erheblich. So erscheint die Herstellung eines leichten,
strahigetriebenen und teilweiss aun Ersatzwerkstoffen gebauten
Jagdflugzeuges, das in kürzester Zeit zu produzieren war, logisch: Die
Stunde des „Volksjägers" war gekommen.

Der systematische Einsatz von KZ-Häftlingen in der Rüstungsindustrie,
und dabei nahm die Luftrüstung einen gewichtigen Anteil ein, begann
1942/43. Es kam im Zuge der sich abzuzeichnenden Kriegswende zur
Steigerung der Rüstungsproduktion, gleichzeitig musste die Industrie
tausende Arbeitskräfte an die Wehrmacht abgeben. Bereits im Februar
1942 hatte die SS mit der Schaffung des Wirtschafts- und
Verwaltungshauptamtes" (WVHA), dem nun die Konzentrationslager
unterstanden und das die wirtschaftlichen Aktivitäten der SS zu
koordinieren hatte, diesem Umstand Rechnung getragen. „Aus dieser
Erkenntnis ergeben sich notwendige Maßnahmen, welche eine allmähliche
Überführung der Konzentrationslager aus ihrer früheren einseitigen
politischen Form in eine den wirtschaftlichen Aufgaben entsprechende
Organisation erfordern", schrieb der Leiter des WVHA Pohl im Herbst
1942 an den Reichsführer SS Himmler, der aber seine
nationalsozialistischen Grundsätze noch gewahrt wissen wollte.
Gleichzeitig war die Verfügbarkeit über tausende Arbeitskräfte, die
dringend gebraucht wurden, ein Machtfaktor für seine politischen Pläne.
Die SS nahm billigend hin, wenn KZ-Haftlinge infolge rücksichtsloser
Arbeitseinsätze starben, allerdings zielten diese Einsätze nicht primär
auf die systematische Vernichtung der arbeitsfähigen Häftlingsgruppen.
Ihre Geschäftsinteressen verliefen parallel zu den ideologischen
Zielvorgaben.
Vorerst versuchte die SS selbst Rüstungsaufträge zu akquirieren und in
den KZ ausführen zu lassen. Die Pläne für ein eigenes Rüstungsimperium
scheiterten jedoch schnell. Weder das Rüstungsministerium noch die
privatwirtschaftliche Industrie konnte diesen Plänen etwas abgewinnen
und wehrte sich vehement.
Ab 1943 stieg der Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge stetig an, die
Häftlingszahlen erhöhten sich dramatisch. Da mit dem Rückzug der
Wehrmacht aus den besetzten Gebieten auch die Aufbringung von
Arbeitskräften, die man zwangsweise ins Reich deportierte, immer mehr
abnahm, und auch kaum mehr Kriegsgefangene gemacht wurden, musste die
SS für die Aufbringung entsprechender Häftlingszahlen sorgen. Entgegen
der zentralen ideologischen Forderung, dass das Reich judenfrei zu
machen sei (- und auch schon war -) , kamen u.a. im März 1944 nach der
Besetzung Ungarns von dort Juden als Sklavenarbeiter zurück ins
"Altreich". Hitler selbst musste das genehmigen. Zudem erfolgte eine
rigorose "Auskämmung" unter der Bevölkerung in noch besetzten
westlichen und südlichen Teilen Europas und die willkürliche Einweisung
von östlichen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Gleichzeitig
entstand ein immer größer werdendes Netz an KZ-Außenlagern, unmittelbar
bei den Rüstungsbetrieben, die einen derartigen Einsatz vom WVHA
genehmigt bekamen. Der Einsatzträger stellte die Unterkünfte; die SS
übernahm Transport, Bewachung, Verpflegung, Bekleidung und medizinische
Versorgung der Häftlinge, wobei im Einzelnen auch abweichende
Regelungen getroffen wurden, besonders im letzten Kriegsjahr. Die
Betriebe mussten eine Gebühr für die Überlassung der Häftlinge zahlen
(4-6 RM). Ende 1944 befand sich bei den meisten KZ-Komplexen die große
Mehrzahl der Häftlinge in den Außenlagern.
Für jüdische Häftlinge bedeutete der Zwangsarbeitseinsatz meist nur
einen Aufschub des Todesurteils. Doch auch die anderen KZ-Häftlinge
waren ständig vom Tod bedroht. Insbesondere bei den Baukommandos waren
sie einfach nur "Menschenmaterial". Ohne entsprechende Kleidung kaum
geschützt, mussten sie bei jeder Witterung Schwerstarbeit verrichten.
Wurde ein Häftling durch Krankheit oder Verletzung arbeitsunfähig, so
wurde er ins Stammlager zurücktransportiert oder in eines der
berüchtigten Krankenlager eingewiesen, beides bedeutete oft den Tod.
Konnten KZ-Häftlinge dagegen in einer Werkshalle arbeiten, so hatten
sie einerseits wegen des Schutzes vor der Witterung und andererseits
wegen ihrer Einbindung in den Produktionsprozess bessere Chancen.
Allerdings waren die Bedingungen in den zahlreichen unterirdischen
Produktionsstätten meist ebenfalls sehr schlecht. Hunger, Kälte und
rassische Diskriminierung waren im täglichen Kampf ums Überleben die
bestimmenden Faktoren.
Das einzige Konzentrationslager auf österreichischem Gebiet war
Mauthausen. Es zählte neben Dachau, Flossenburg und Buchenwald zu den
"ökonomisch" bedeutendsten Arbeitslagern mit einer großen Anzahl von
Außenlagern, die dem Bereich Luftrüstung und V-Waffen zuzuordnen waren.
Dazu gehörten auch die Produktionsstätten der Firma Heinkel in
Ostösterreich. Heinkel, der 1942 mit dem Werk Oranienburg eine Art
Vorzeigewerk für den Einsatz von KZ-Häftlingen errichtete, bekam ab
Sommer 1943 Häftlinge zugewiesen, die in Baracken am Rande des
Werksgeländes in Schwechat/Heidfeld untergebracht waren. Das Lager,
"Lager Schwechat 2" genannt, wurde nach dem zweiten großen
Bombenangriff auf Heidfeld im Juni 1944 , der wie der erste Angriff im
April zahlreiche Opfer unter den KZ-Häftlingen gefordert hatte, im Juli
großteils ausgelagert und auf mehrere Keller in Schwechat und
Wien-Floridsdorf verteilt. Ein Teil der Häftlinge kam nach Hinterbrühl,
wo man sie vorerst zu den Ausbauarbeiten der Seegrotte, die man dann
als Werk "Languste" bezeichnete, einteilte. Neben der Grotte entstand
dann ein Lager, das unter dem Namen "Lisa" geführt wurde. In den
Statistiken sind alle diese Lager und Sublager unter KZ-Außenlager
Floridsdorf zusammengefasst. Daher ist auch die Anzahl der Häftlinge in
diesen Lagern nur sehr schwer feststellbar, die Forschung geht heute
von ca. 2.700 Personen aus.
Ende März 1945 begann der letzte Akt des Dramas. Da die Sowjets immer
näher kamen, wurden am 1. April die Insassen der Lager in Wien und
Hinterbrühl, wie bei anderen Konzentrationslagern auch, in
Evakuierungsmärschen, die dann als sogenannte "Todesmärsche" bekannt
wurden, nach Mauthausen getrieben. Das mit äußerster Brutalität
vorgehende SS-Personal erschoss jeden, der flüchten wollte oder aus
Schwäche nicht mehr weiter konnte, insgesamt mehr als 300 Personen.
Zuvor wurden im Lager Lisa die im Krankenrevier liegenden ca. 50
Häftlinge mit Injektionen getötet. Nach einer Aufzeichnung im Lager in
Mauthausen sind dort 1650 Häftlinge aus dem Außenlager Floridsdorf
aufgenommen worden.
Bei der Befreiung des Lagers Mauthausen im Mai 1945 lebten noch 64.800
Männer und 1.734 Frauen. 6.000 ehemalige Häftlinge starben in den
Wochen und Monaten nach der Befreiung an den unmittelbaren Folgen der
Zwangsarbeit und der Todesmärsche.



Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: