web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Pöllau
bei Hartberg, August 2024
Die Marktgemeinde Pöllau mit knapp 6000 Einwohnern befindet sich im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark (Österreich). Sie ist der Hauptort des Naturparks Pöllauer Tal. Das ehemalige Stift Pöllau wird auch als Schloss Pöllau bezeichnet. Es geht auf eine Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert zurück. Darin befindet sich die Stifts- und Pfarrkirche St. Veit und echophysics, das Museums zur Geschichte der Physik.

Das weithin sichtbare Wahrzeichen des Pöllauer Tales ist die auf
Fernwirkung bedachte Kirche mit dem markanten Turm und der mächtigen
Kuppel. Mit Recht wird sie auch der „Steirische Petersdom“ genannt.
Schon die Größenordnung lässt erahnen, dass die Bedeutung weit über die
einer Pfarrkirche hinausgeht. Erst wenn man von oben vom Pöllauberg ins
Tal hinunter schaut, kann man den großzügigen Gebäudekomplex des
ehemaligen Stiftes Pöllau überblicken. Ohne das fast dreihundertjährige
Wirken der Augustiner Chorherren in Pöllau wäre diese Anlage in der
heutigen Form undenkbar. Untrennbar damit verbunden ist auch die
Entwicklung des Marktes und des gesamten Tales seit dem Mittelalter bis
in unsere Zeit. Das reizvolle Ensemble des ehemaligen Stiftes wird von
Einheimischen immer noch „Schloss“ genannt. Mit der prächtigen Kirche
zusammen erweckt es nun bei Kunstfreunden Bewunderung und Staunen, was
früher als Ausdruck inniger barocker Religiosität gedacht war. Einst
wie heute ist das ehemalige Stift aber auch geistiges und geistliches
Zentrum. Kunst und Geist sind hier in Pöllau mit der einzigartigen,
durch Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaft eine besondere
Symbiose eingegangen.

RAIMUND OCHABAUER PLATZ
Raimund Ochabauer (1935-2009) war von 1975-2009 Pfarrer in Pöllau,
Ehrenbürger der sechs Gemeinden des Naturparks Pöllauer Tal und ab 1995
Obmann des Tourismusverbandes.
(Hannes Fladerer, Portrait Raimund Ochabauer, Bronzeguss, 2011/12)

Die Stifts- und Pfarrkirche St. Veit ist nicht nur der größte barocke
Kirchenbau der Steiermark, sondern auch der Schlüsselbau für den
oststeirischen Spätbarock. Sie wurde von 1701 bis 1709 von Joachim
Carlone erbaut und durch Mathias von Görz mit Fresken ausgestaltet. Die
Kirche ist dem Hl. Veit geweiht. Da der Grundriss der Kirche dem
Petersdom in Rom nachempfunden ist und auch ihre Kuppel an der
Petersdom erinnert, wird die Kirche als „Steirischer Petersdom“
bezeichnet. Seit 1990 ist sie Tochterkirche der Lateranbasilika.

Ausmaße der Stifts- und Pfarrkirche St. Veit
Gesamtlänge: 62,5 m
Breite im Querschiff: 37 m
Höhe im Hauptschiff: 21,4 m
Höhe in der Kuppel: 42 m
Höhe des Turmes: 53 m
Bemalte Decken- und Wandflächen: 9.120 m²
Anzahl der Altäre: 15
Anzahl der Fenster: 54 (ca. 400 m²)
Kuppeldurchmesser: 13 m
Kuppelgewölbe: 310 m²

Die Johannes-Nepomuk-Kapelle
links von der Kanzel war einst der Abgang in die Gruft der verstorbenen
Prälaten des Stiftes. Unter dem Fenster ist der farbig gestaltete
Grabstein des Propstes Michael Josef Maister (+1696) eingemauert. Dem
verdienten Initiator und Bauherren der neuen Stiftsanlage wurde damit
ein Denkmal gesetzt. Das Altarblatt von Joseph Adam von Mölckh zeigt
den Hl. Nepomuk, wie er gerade an Arme Almosen verteilt. Das Fresko an
der gegenüberliegenden Wand stellt die Gefangennahme des
„Brückenheiligen“ Nepomuk an der Moldaubrücke und sein Martyrium durch
Ertränken dar. Er wurde Opfer des Beichtgeheimnisses und erlitt 1393 zu
Prag unter König Wenzel von Böhmen den Märtyrertod.
In der Kreuzkapelle rechts von
der Kanzel finden wir zwei Werke von Martino Altomonte. Das große
Altarblatt, datiert 1725, ist eines seiner Meisterwerke und stellt
erschütternd realistisch den sterbenden Christus und unter dem Kreuz
die weinende Mutter Maria, Maria Magdalena und Johannes dar. Das
kleinere Bild darüber zeigt Christus am Ölberg, wie er von einem Engel
Tröstung empfängt. Die gotische Marienklage (Pieta) vor dem Altarblatt
stammt noch aus der alten mittelalterlichen Stiftskirche.

Der Kircheninnenraum verfügt neben dem Volksaltar und dem Hochaltar noch über 13 weitere Seitenaltäre.

Wie ein Fresko entsteht
Bei der Freskomalerei (italiensch: al fresco = ins Frische) werden die
in Kalkwasser angerührten Farben auf den frischen, feuchten Kalkputz
aufgetragen, wobei sie sich unlöslich mit dem Untergrund verbinden.
Beim Trocknen entsteht eine homogene Schicht mit den eingearbeiteten
Farbpigmenten. Diese Farbe kann nicht mehr abblättern. Die Technik ist
aber deshalb so schwierig, weil Putz und Farbe am selben Tag
aufgetragen werden müssen. Eine Korrektur ist nicht mehr möglich. Der
Auftrag des Putzes für den nächsten Tag muss vor allem sehr sorgfältig
gemacht werden. Die entstehenden „Stöße“ sind mitunter gut erkennbar.
Beliebt war die Freskomalerei schon in der Antike (z. B. in Pompeji).
Der bedeutendste Freskenzyklus ist der von Michelangelo in der
Sixtinischen Kapelle.

Foucault’sches Pendel - zu sehen in der Pfarrkirche Pöllau
Im Jahr 1851 führte Léon Foucault im Pantheon von Paris einen
spektakulären Versuch durch: Eine 28 kg schwere Messingkugel wurde an
einem 67 m langen Stahlseil aufgehängt und in Schwingung versetzt. Nach
einiger Zeit beobachtete man, dass sich die Schwingungsebene des
Pendels scheinbar verändert hatte. In Wirklichkeit hat sich aber die
Erde unter dem Pendel weitergedreht. Das war eines der ersten
Experimente, das einen direkten Nachweis für die Erddrehung lieferte.
Einen verkleinerten Nachbau dieses Experimentes können Sie hier
bestaunen!

Die Kanzel
Am Schalldeckel der holzgeschnitzten Kanzel ist der hochdramatische
Augenblick der Bekehrung von Saulus dargestellt. Auf dem Ritt nach
Damaskus wird der Christenverfolger vom himmlischen Licht geblendet,
stürzt vom Pferd und vernimmt den Ruf: „Saulus, Saulus, warum verfolgst
du mich?“ Er erkennt das Zeichen und wird zum Völkerapostel Paulus. An
der Brüstung der Kanzel sind vier allegorische Figuren: Glaube, Liebe,
Hoffnung, Standhaftigkeit. Sie symbolisieren jene Tugenden, die der
Prediger selbst besitzen und seinen Zuhörern vermitteln sollte. Die um
1775 entstandene Kanzel wird dem Bildhauer Jakob Peyer zugeschrieben.

Gliederung des Kirchenraumes - Die Gliederung und Ausschmückung des
Lang- und Querhauses geht in wesentlichen Zügen auf die Konzeption
Domenico Sciassias zurück.
Die in zwei Geschoßen eingebauten Fensterreihen und die acht Fenster
des hohen Kuppelunterbaues bewirken eine Lichtfülle, die den Innenraum
in seiner ganzen barocken Pracht erstrahlen lassen. Dieses Raumschema
mit der Verknüpfung von Langhaus und Zentralbau wurde schon hundert
Jahre vorher im Salzburger Dom vorgegeben. Die Wände des Langhauses
werden durch je drei Seitenkapellen und darüber liegenden Emporen
geöffnet. Die monumentalen Pfeiler zwischen den Rundbögen werden von
korinthischen Kapitellen gekrönt. Dies sind die einzigen
Stuckverzierungen in dieser Kirche. Die Brüstungen der seitlichen
Emporen und der über der Vorhalle gelegenen Orgelempore wölben sich in
feiner Schwingung nach vorne. Hier zeigt sich der Einfluss der Vorauer
Emporen des dort wirkenden Baumeisters Matthias Steinl. Sein Schüler
Remigius Horner wiederum wirkt federführend am Pöllauer Kirchenbau.

Der Rosenkranzaltar
Im nördlichen Halbrund des Querschiffes, vor dem Ausgang zur Sakristei,
befindet sich der Rosenkranzaltar. Das 1722 datierte Altarblatt wird
als eine der besten Arbeiten des Vorauer Stiftsmalers Johann C.
Hackhofer bezeichnet. Der Altaraufbau ist ein Werk von Remigius Horner.
Die Kolossalstatuen Josef, Elisabeth, Anna und Joachim stammen wie die
Figuren des Augustinusaltars vom Grazer Bildhauer Marx Schokotnigg.

Der Freskenschmuck - Das malerische Konzept des Matthias von Görz
Die Grundidee der gewaltigen „Gemäldesinfonie“ in der Pöllauer Kirche
ist kurz gesagt: „Durch das Erdenleben Gott entgegen“. Auf den Altären
finden wir die Heiligen im Lebenskampf und Martyrium. Auf den
Deckengewölben schweben sie dem Himmel zu. Nach dem Jüngsten Gericht,
das am Tonnengewölbe im Mittelpunkt steht, ziehen alle Auserwählten hin
zum Himmel, der in der Kuppelwölbung dargestellt wird. Mit den Engeln
finden sie dort ihre Seligkeit in der göttlichen Liebe und jubeln der
Heiligsten Dreifaltigkeit zu, die der Maler am höchsten Punkt, in der
Laterne der Kuppel platziert hat. Die Wurzeln und Quellen der
malerischen Ausgestaltung der Stiftskirche durch den heimischen Maler
Matthias von Görz sind bei den Meistern zu finden, die er bei seinen
Studien in Graz, Wien und Italien kennen gelernt hatte. Görz verwendete
viele Vorbilder, die er als Skizzen von seinen Studienreisen
mitbrachte, und versuchte sie in seinen monumentalen Freskengemälden zu
neuen Kompositionen zusammenzustellen.
Sein Auftraggeber Propst Ernest von Ortenhofen wird wohl gemeinsam mit
dem Künstler das Gesamtprogramm entworfen haben. Görz lernt über seinen
Grazer Lehrer Mathias Echter und dessen Feund Fischer von Erlach J. M.
Rottmayer kennen. Aus dessen Arbeiten an der Wiener Peterskirche
(1713/14) übernimmt Görz eine Reihe Figurengruppen, die er hier in
Pöllau „neu aufstellt“. Aus der Kirche S. Andrea della Valle in Rom
übernimmt Görz die Darstellung der vier Evangelisten (in den
Verschneidungen von Kuppel mit Lang-und Querhaus) fast „wörtlich“ und
nimmt von dort auch die Himmelfahrt Mariens zum Vorbild. Das gemalte
dritte Arkadengeschoß im Tonnengewölbe ist unverkennbar an Pozzos
Werk zu S. Ignazio in Rom orientiert. Die inhaltliche Einheit der
Deckengemälde im Tonnengewölbe, in der Kuppel und in den Wölbungen der
drei Konchen und deren meisterliche Ausführung durch Matthias von Görz
sind der wahre Schatz der Pöllauer Kirche.

Der Augustinusaltar
Im südlichen Abschluss des Querschiffes befindet sich der Altar des
Ordenspatrons der Chorherren. Das Altarblatt malte Mölckh 1778 und
zeigt den Hl. Augustinus in bischöflicher Kleidung an seinem
Schreibtisch. Aus seiner Schreibfeder zucken Blitze gegen die beiden
Irrlehrer Manichäus und Pelagius. Darüber ist die Heiligste
Dreifaltigkeit mit dem thronenden Gottvater, Christus mit dem Kreuz und
dem heiligen Geist in der Gestalt der Taube dargestellt. Wie schon im
Hochaltarraum setzt sich auch hier im Gewölbe die Heiligendarstellung
durch seine Himmelfahrt fort. Daneben wiederum vier Apostel in gemalten
Arkaden im Halbrund. Die mächtige Säulenkonstruktion der barocken
Altaraufbauten stammt aus der Kunsttischlerwerkstätte von Remigius
Horner.

Die Verschneidung von Lang- und Querhaus unter der Kuppel bildet mit
den drei im Halbrund kleeblattartig anschließenden, gerundeten
Altarräumen jenen zentralen Raum, der durch Lichtwirkung und Gestaltung
unweigerlich jeden Blick auf sich lenkt. Die hier in seltener
Vollkommenheit erreichten hochbarocken Stilformen finden in der
lichtdurchfluteten Kuppel sowohl architektonisch wie
malerisch-programmatisch ihren Höhepunkt: Matthias von Görz gestaltete
in der Kuppelwölbung den Himmel mit der Verehrung der heiligsten
Dreifaltigkeit in der Kuppellaterne und hat mit diesen Meisterwerken
hochbarocker Fresken, seinem Lebenswerk, in Pöllau ein Denkmal gesetzt.
Die Kuppel
Die Darstellungen im Tonnengewölbe streben der Kuppel als Mittelpunkt
und Höhepunkt zu. Sie symbolisiert mit einer Unzahl von Engeln, die in
konzentrischen Kreisen angeordnet sind, den Himmel. Die kleiner
werdenden Kreise und die helleren Farben verstärken den Eindruck der
unendlichen Weite. Teilweise spielen die himmlischen Gestalten
Musikinstrumente oder tragen heilige Geräte. Schließlich vollendet sich
das Geschehen im Anblick der Heiligsten Dreifaltigkeit in der Wölbung
der Kuppellaterne. Im Kuppelunterbau sind zwischen den Fenstern in
allegorischen Gestalten die Kardinaltugenden dargestellt, wie z. B.
Nächstenliebe, Hoffnung, Gerechtigkeit. Ein starkes Zeichen setzt der
Künstler mit den vier Evangelisten zwischen den Gewölbebögen des Lang-
und Querhauses. Auf ihnen ruht die Kuppel. Als Verkünder des Wort
Gottes bilden sie gleichsam das Fundament des Himmels.

Der Heilige Veit (Vitus)
Der Heilige lebte zur Zeit des Christenverfolgers Kaiser Diokletian und
starb um 304 n. Chr. Auf dem Hochaltarblatt von Mölckh erwartet Vitus
verklärt sein Martyrium - den Tod im Kessel mit siedendem Öl. Seine
christlichen Erzieher Modestus und Crescentia sind in Ketten gelegt.
Der Vater Veits, Hilas, bringt einem Götzenbildnis Opfer dar und
versucht seinen Sohn vom christlichen Glauben abzubringen, um sein
Leben zu retten. Hoch zu Ross erwartet Kaiser Diokletian die Exekution
des Heiligen. Der Hl. Veit ist Schutzpatron der Gastwirte, Bierbrauer,
Winzer und der Jugend. Er wurde gegen Krämpfe, Tollwut und Epilepsie
(„Veitstanz“) um Hilfe angerufen. Vitus als Kirchenpatron ist sehr
häufig in Rückzugsgebieten slawischer Bevölkerung zu finden, was auch
im Pöllauer Tal der Fall gewesen sein dürfte. Sein Haupt ist im
Veitsdom in Prag aufbewahrt. Gedenktagist der 15. Juni.

Der Hochaltar
Wie schon die Vorgängerkirche innerhalb der mittelalterlichen Burg ist
auch die Stiftskirche dem HI. Veit geweiht. Sein Martyrium zeigt das
Altarblatt von Josef Adam Ritter von Mölckh, das 1779 geschaffen wurde.
Die Darstellung setzt sich im Fresko an der Decke fort, das über dem
segnenden Papst die Himmelfahrt des Hl. Veit zeigt. Daneben sind
in gemalten Arkaden die vier Apostel Jakobus d. Ä., Petrus,
Andreas Johannes (von links) zu sehen. Die heutige Ausstattung
des Hochaltarraumes dürfte zu den letzten Arbeiten an der Kirche vor
der Stiftsaufhebung gehört haben. Die Aufbauten im Empire-Stil stammen
gar erst von 1804, ebenso die flankierenden Figuren der Märtyrer Johann
und Paul.
Über dem Ausgang zur Sakristei ist die gemalte Stiftschronik
beachtenswert. In der gegenüberliegenden Seitenwand befindet sich die
Grabplatte des Stifters und des Chorherrenstiftes Pöllau, Hans von
Neuberg (+1483) und seiner Schwester Elisabeth. Der neue Volksaltar
wurde nach einem Entwurf des Architekten Jörg Uitz vom einheimischen
Steinmetz Johann Schweighofer gefertigt und nach Beendigung der letzten
großen Renovierung 1990 geweiht.

Die Altaraufbauten
Die barocke Pracht der ehemaligen Stiftskirche ist vor allem der
Farbigkeit der bemalten Flächen zuzuschreiben. Im Gegensatz zu anderen
bekannten barocken Kirchen sind hier Vergoldungen sehr bescheiden
eingesetzt. Auf Stuck als Umrahmung von Bildmotiven wird überhaupt
verzichtet. Die Materialien der Mauerpfeiler im Langhaus und die
Altaraufbauten der Seitenaltäre scheinen sehr kostbar zu sein. Gleich
vorweg - Marmor wurde in dieser Kirche nicht verwendet. Wie der
Künstler Matthias von Görz den Raum mit der gemalten illusionistischen
Architektur erweitert, so sind auch die meisten „kostbaren“ Materialien
der Säulen, Gesimse, Platten und anderen Zierrats an den Seitenaltären
nur Illusion.
Die Altäre - mit Ausnahme des Hochaltars - gehen auf Entwürfe und
Arbeiten aus der Werkstätte des Kunsttischlers Remigius Horner zurück.
Die fein gearbeiteten Holzkonstruktionen mussten für die Bemalung durch
besonders sorgfältige Grundierung vorbereitet werden. Das Mittel zur
Grundierung ist eine Verbindung aus tierischem Leim und verschiedenen
Sorten Kreide, die in warmem Zustand mit weichem Pinsel in mehreren
Schichten aufgetragen wird. Jede Schichte wird nach dem Trocknen
geschliffen. Diese Technik hatte im 18. Jh. große Bedeutung.

Großen Eindruck hinterlässt die Farbigkeit der Pöllauer Kirche, die
durch rund 9.000 m² bemalter Flächen erreicht wird. In Konzeption und
Wirkung geht die Ausgestaltung der Kirche weit über die frühbarocke
Formensprache in Vorau und Mariazell hinaus. Während dort schwerer
Stuck ein wichtiges Schmuckelement ist, wird das Innere der Pöllauer
Kirche durch die Leichtigkeit der gemalten Architektur belebt.
Diese illusionistische Raumerweiterungsmalerei nach italienischen
Vorbildern wirkte beispielgebend für spätere Kirchenbauten.
Himmelfahrt des Hl. Veit. Deckenfresko über def Hochaltar.

Die Orgel von Johann Georg Mitterreither aus dem Jahre 1741, welche
über 24 klingende Register verfügt und in fast allen Teilen original
aus der Barockzeit erhalten ist, wurde 1989 von Helmut Allgäuer
restauriert und besitzt eine akustisch wunderbare barocke Klangfärbung.
Über dem Werk ist am Deckenfresko der singende König David abgebildet,
welcher im Kreise musizierender Engel Gott ein Loblied anstimmt.

Orgel und Orgelempore
Die 1739 von Georg Mitterreither erbaute Orgel ist nach der Renovierung
1988 wieder in fast allen Teilen im Original erhalten und ein
Klangdenkmal ersten Ranges. Unter Musikern und Sängern ist die
besondere akustische Qualität der Orgelempore bekannt. Die Beschallung
des doch sehr großen Kirchenraumes ist von hier aus optimal möglich -
ohne echoähnliche Überlagerungen.
Hinter der Orgel befindet sich das prächtige barocke Chorgestühl, das
Remigius Horner zugeschrieben wird. Im Sommer diente es einst den
Chorherren für das täglich mehrmalige Chorgebet. In einer gemalten
Kuppel über der Orgel sitzt der königliche Sänger David inmitten einer
Schar musizierender Engel. In einem Spruchband fordert er uns auf, Gott
in seinem Heiligtum zu loben.

Das Deckengemälde im Langhaus
Das Tonnengewölbe im Mittelschiff beeindruckt durch den fast nahtlosen
Übergang der Architektur zur Freskomalerei. Die gemalten Arkaden
erhöhen noch das Gewölbe, das sich förmlich in den freien Himmel
aufzulösen scheint. In den Arkaden die Kirchenväter als Verkünder des
über ihnen dargestellten Geschehens: Hieronimus und Augustinus im
Süden, dazwischen Isidor, Ambrosius und Gregor im Norden, dazwischen
Prosper. Im Deckenfresko selbst ist die belehrende Absicht des
Künstlers Matthias von Görz spürbar: Am Tag des Jüngsten Gerichts
werden die Verdammten in das höllische Verderben gestürzt, während die
Gerechten mit Maria und den Heiligen der Herrlichkeit des Himmels
entgegen sehen. In hellem Licht erstrahlt das Kreuz. Optisch wie
thematisch steht die Verehrung des apokalyptischen Lammes als Symbol
für Jesus Christus im Mittelpunkt. Unzählige Engelsfiguren nähern sich
in Form einer Monstranz dem Lamm. Im Halbkreis darunter angeordnet die
Gruppe der Heiligen aus dem Alten und Neuen Testament. Die Gottesmutter
Maria wird flankiert von Franz von Assisi, Dominikus und Johannes
Nepomuk.
Ohne besondere Gliederung sind die einzelnen Gruppen, zum Teil auf
Wolken schwebend, zu einem Gesamtkunstwerk komponiert. Es ist ein
Schau- und Suchbild für den barocken Gläubigen, gleichzeitig eine
Mahnung durch den Chor der Heiligen, im Erdenleben dafür Sorge zu
tragen, dass man im ewigen Leben dieser triumphierenden Kirche
angehören dürfe.

Die Fresken gelten als der große Schatz der Kirche. Ihr Maler, Mathias
von Görz, schuf hier sein größtes Meisterwerk, indem er ganz auf
Stuckdekorationen verzichtete und stattdessen die gesamten
Gewölbeflächen mit Freskenmalereien schmückte. Görz bediente sich
hierbei besonders stark der illusionistischen Architekturmalerei, ganz
nach italienischen Vorbildern, wodurch der große Innenraum eine noch
weitere Wirkung entfaltet. Mathias von Görz vertiefte sein Talent durch
Studien in Graz, Wien und Italien, wo er Skizzen von Freskenmalerei
anfertigte, die er von seinen Studienreisen mitbrachte und anschließend
versuchte, sie in seinen monumentalen Freskengemälden zu neuen
Kompositionen zusammenzustellen.

Die programmatischen Ausgestaltungen der Fresken der Kirche korrelieren
miteinander: Während in den Seitenkapellen und auf deren Altären die
Heiligen und Märtyrer in ihrem Leben bzw. Martyrium dargestellt sind,
schweben sie auf dem Deckengewölbe im Langhaus dem Himmel entgegen.
Nach dem Jüngsten Gericht, welches den Mittelpunkt des Tonnengewölbes
im Langhaus einnimmt, ziehen alle von Gott Auserwählten in der Kuppel
weiter nach oben in den Himmel, welcher in der Kuppelwölbung abgebildet
ist. Vereint mit den Scharen der Engel finden sie hier ihre Seligkeit
und jubeln der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zu, welche im höchsten
Punkt der Kuppel, in der Kuppellaterne, vom Kirchenboden aus kaum
sichtbar, platziert ist. Die Engel selbst sind in der Kuppelwölbung in
einer Unzahl in Form von konzentrischen Kreisen angeordnet, welche
immer weiter nach oben kreisen.

Die prunkvolle Mariensäule am Hauptplatz

Rathaus der Marktgemeinde Pöllau am Hauptplatz

Kriegerdenkmal im Innenhof vom Schlosshof

Innenhof vom Schlosshof mit Kriegerdenkmal

echophysics ist der Name eines Museums zur Geschichte der Physik, das
sich im Schloss Pöllau bei Hartberg in der Steiermark befindet. Der
Name ist ein Akronym aus European Center for the History of Physics
(Europäisches Zentrum für Physikgeschichte).

10.000 W Glühlampe, Osram

Spiegelgalvanometer, Siemens & Halske, Wien - Strommessgerät
Binantenelektrometer nach Dolezalek, Georg Bartels, Göttingen - Gerät sowohl für Spannungs- als auch Ladungsmessung
Spiegelgalvanometer, Siemens & Halske, Wien - Messgerät für ballistische Messungen

Radioaktivität und Elektrizität
Dass Anfang des 20. Jahrhunderts die Messung der Elektrizität zu der
Herausforderung dieses Fachgebietes der Physik wurde, ist bedingt durch
die Tatsache, dass der (Ende des 19. Jahrhunderts) entdeckte
radioaktive Zerfall mit der Emission von geladenen Teilchen einhergeht,
die in Materie ihrerseits neutrale Atome zu Ladungsträgern (Ionen)
machen, was wiederum zum (messbaren) Abfallen von vor- handenen
Spannungen führt. Als Maß der Intensität der Strahlung radioaktiver
Substanzen wurde daher in erster Linie die durch sie bewirkte
lonisation der Lufi herangezogen. Dabei handelt es sich praktisch stets
um die Messung eines schwachen elektrischen Stroms durch
galvanometrische (Ladung messende) oder elektrometrische (Strom
messende) Methoden.
Atmosphärische Elektrizität
Wurde die Stärke radioaktiver Präparate auf Grund ihrer ionisierenden
Wirkung bestimmt, so erwartete man umgekehrt von der Messung der
atmosphärischen Elektrizität einen Aufschluss über die Stärke und das
Auftreten einer noch unbekannten verursachenden Strahlung, von der man
annahm, dass sie von im Boden enthaltenen radioaktiven Substanzen
herrühren würde. Die atmosphärische Elektrizität war das
Forschungsgebiet von Viktor Franz Hess. Er bestimmte den Ionengehalt
der Atmosphäre unter verschiedenen Bedingungen. Er begann damit, die
Ionisation durch Gammastrahlung in Luft mit einem Radiumpräparat zu
messen. 1500 Milligramm Radium standen ihm zur Verfügung. Aus diesen
Messungen konnte er genau feststellen, wie die ionisierende Wirkung der
Gammastrahlung mit der Entfernung infolge der Absorption in der Luft
abnimmt. Diese Meßergebnisse würden dann später entscheidend für seine
Feststellung werden, dass die in großer Höhe beobachtete Ionisation
nicht von der radioaktiven Strahlung des Bodens herrühren kann.
Die Entdeckung der Kosmischen Strahlung
Hess deutete an, diese Kosmische Strahlung müsse ähnlich wie die
Strahlung radioaktiver Stoffe, aber von wesentlich grösserer
Durchdringungsstärke sein, da sie ja die ganze Atmosphäre zu
durchlaufen imstande sei. Tatsächlich entspricht die
Strahlungsabschirmung durch die Atmosphäre der einer Schicht aus Blei
von ein Meter Dicke, was mindestens zehn Mal die maximale Bleidicke
darstellt, welche von den härtesten Gammastrahlen noch durchdrungen
werden kann. Die Dimensionen der gegen diese kosmische „Höhenstrahlung"
benötigten Abschirmung würden so groß sein müssen, dass kaum andere als
die von der Natur gebauten Hindernisse diesen Bedingungen gerecht
werden könnten, so wie die Wassermassen der Meere, die Erdkruste und
die Atmosphäre selbst. So ist es auch zu dieser Verschiedenheit der
Standorte gekommen, an welchen solche Messungen ausgeführt wurden.
Wo hat man die kosmische Strahlung nicht gemessen? Einige merkwürdige
Beispiele: Sie wurde unter einem Haufen von Meersalz in den Salinen
gemessen, im Rohr einer Kanone mit sehr großem Kaliber - wo hinein man
nicht nur den Apparat, sondern auch den Beobachter bringen musste, in
den Katakomben von Paris, in Kohle-, Eisen- und Kupferbergwerken, in
Grotten, Gletscherspalten und auf den Gipfeln der höchsten Berge. Sie
wurde im Flugzeug, im Freiballon gemessen, aber auch auf dem Grund der
Seen, der Fjorde Norwegens, des Roten Meeres - in jeder Höhe oder Tiefe
und auf allen Breitengraden. Die Physiker mussten große Sportsleute
sein, Bergsteiger und Höhlenforscher zugleich; aber sie mussten auch
leichte und gut transportable Apparate bauen, die in niedrigen
Schächten oder in Schutzhütten im Hochgebirge aufgestellt werden
konnten. Weitere wichtige Höhenstrahlenforschungen wurden - etwa
zeitgleich zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts - von
Victor Franz Hess in der eigens am Hafelekar bei Innsbruck auf 2269 m
Seehöhe errichteten Messtation und von dem italienischen Physiker Bruno
Rossi in einer Holzhütte im Hochland von Asmara in Eritrea in über 2000
m Seehöhe durchgeführt. Hess: „Die Arbeiten auf dem Hafelekar kann ich
wohl zusammen mit jenen des Jahres 1912 - die zur Entwicklung dieser
neuen Strahlung geführt haben - als mein Lebenswerk bezeichnen."

Zeit und Strahlung - Was ist Zeit?
Zeit ist wahrgenommene - empfundene oder gemessene - Bewegung im Raum.
Bewegung findet in der Zeit statt, oder umgekehrt, vollkommener
Stillstand bedürfte der Zeit nicht.
Was hat Zeit mit der Strahlung zu tun?
Strahlung ist bewegte Energie. Strahlung kennt keinen Stillstand.
Strahlung kann man sich als eine ununterbrochene Raumerfüllung mit
Energiepaketen vorstellen. die sich von der Strahlungsquelle
unvorstellbar schnell in den umgebenden Raum ausbreiter: Lichtstrahlung
pflanzt sich im Vakuum mit der Grenzgeschwindigkeit unseres Universums
fort, mit Lichtgeschwindigkeit, das sind etwa 300.000 km pro Sektinde.
Strahlung braucht also Zeit um anzukommen. Das Sonnenlicht, das uns
blendet, hat sich vor etwa 8 Minuten an der Sonnenoberfläche auf den
Weg gemacht; wir sehen das Leuchten von Sternen, die so weit entfernt
von uns sind, dass wir nicht wissen, ob der Stern überhaupt noch
existiert oder wir nur mehr sein Leuchten aus vergangenen Jahrmillionen
sehen.
Um solche gigantische Reisezeiten des Lichtes auszudrücken, benutzen
wir die Bewegung der Lichtstrahlung im All: ein Lichtjahr ist die
Strecke oder Distanz, die das Licht in einem Kalenderjahr im Vakuum
zurücklegt. In einer Sekunde reist Licht ca. 300.000 km, in einem Jahr
ist die zurückgelegte Strecke bereits unvorstellbar groß, nämlich 365
(Tage) x 24 (Stunden) x 60 (Minuten) x 60 (Sekunden) x 300,000 km = ca.
9.500 Milliarden oder 9,5 Billionen Kilometer. Betrachten wir nun eine
mechanische Uhr. Die Unruh macht an einem Tag 691.200 Halbschwingungen.
Das ergibt in einem Jahr 252 Millionen und 288.000 Halbschwingungen.
Würde man den Unruh-Reifen (anstelle seiner schwingenden) in eine
rotierende Bewegung versetzen, so würde dieser in einem Jahr einen Weg
von 4.000 km zurücklegen. Feinstmechanik von Menschenhand: 4.000 km
Strecke, um ein Kalenderjahr Zeit irdisch zu messen. Lichtstrahlung im
Vakuum des Alls: 9.500 Milliarden km Strecke, um ein Kalenderjahr
kosmisch zu vermessen.
Bewegung trennt - Zeit verbindet
Turmuhren enthalten das wunderbar ausgeklügelte mechanische Gangwerk,
dessen komplizierte Bewegungsabläufe um einen Mittelpunkt unserem
alltäglichen Tun einst eine Regulierung vorgaben, die Turmuhr verband
die Einzelnen mit der Gemeinschaft in der er sie lebten. Die Moderne
Physik hat uns gezeigt, dass die Zeit die wundersame Dimension ist, die
uns Menschen über die Strahlung, sei es die Strahlung des Lichts oder
die Kosmische Strahlung, mit den unendlichen Weiten des Weltalls - dem
uns umgebenden Ganzen, das keinen Mittelpunkt vorgibt - verbindet.

Fotografie von Geschossstoßwellen
Im Jahr 1886 gelang es Peter Salcher, Professor an der österreichischen
Marineakademie in Fiume (heute Rijeka) erstmals Stoßwellen eines
Gewehr-Geschosses fotografisch festzuhalten. Der von ihm verwendete
experimentelle Aufbau ist hier mit historischen Bauelementen
nachgebaut. Die optische Anordnung entspricht im Prinzip der eines
üblichen Projektors für Diapositive. Eine Lichtquelle (im vorliegenden
Fall eine Funkenstrecke) wird mit Hilfe einer ersten Linse (Kondensor)
in die Ebene einer zweiten Linse abgebildet. Mit dieser erfolgt dann
die Abbildung des unmittelbar nach (oder auch vor) der ersten Linse
positionierten, transparenten Gegenstands (einem Diapositiv oder im
vorliegenden Fall den Stoßwellen eines Geschosses). Abgebildet wird
hier auf eine Fotoplatte. Die vorangegangene Abbildung der Lichtquelle
mit der ersten Linse in die zweite ist lediglich dazu da, um die
Helligkeit des Bildes auf der Projektionsfläche zu erhöhen.
Man kann mit dieser Anordnung sehr einfach auch Orte der
Gegenstandsebene sichtbar machen, an denen nicht die Lichtabsorption
sondern die Dichte bzw. Brechzahl gegenüber der jeweiligen Umgebung
verändert ist, wie bei den Stoßwellen. Dazu wird ein Teil des
abbildenden Lichtbündels vor oder nach der zweiten Linse mit einem
Lineal oder einer gegenüber der optischen Achse versetzten Kreisblende
(Schlierenblende oder Schlieren-Diaphragma genannt) unsymmetrisch
abgedeckt. Die Orte, an denen die Brechzahl anders ist als an deren
jeweiliger Umgebung, erscheinen dann in der Abbildung gegenüber dem
Untergrund heller oder dunkler. Man erzeugt so genannte Schlierenbilder.
Das Problem bei diesem Versuch der fotografischen Erfassung von
Geschossstoßwellen besteht su zu dem Zeitpunkt aufleuchten muss, wenn
sich das Geschoss in der Gegenstandsebene vor der Kondensorlinse
befindet. Kurzzeitphysikalische Tricks mit elektronischen Schaltungen
waren damals noch nicht möglich. Salcher hat das Problem auf folgende
Weise gelöst. Der Funke wird durch Entladung eines Kondensators
(Leydener Flasche) erzeugt. Der Kondensator wird mit Hilfe einer
Influenzmaschine auf eine Spannung geladen, die über der
Durchschlagspannung der Funkenstrecke liegt (Kontrolle mit einem
elektrostatischen Voltmeter). Ein Durchschlag bei der an den
Kondensator angeschlossenen Funkenstrecke wird dadurch verhindert, dass
eine der beiden Zuleitungen durch einen geöffneten Schalter
unterbrochen ist. Dieser Schalter auch eine Erfindung Salchers -
besteht aus einem Glasrohr, in dem sich die beiden Enden der
unterbrochenen Leitung in einer Distanz von wenigen Millimetern
parallel zueinander gegenüberliegen. Das Glasrohr wird in die
Geschossbahn gebracht, mit seiner Achse senkrecht zu dieser. Die
Anordnung der beiden Drahtenden im Glasrohr ist so gemacht, dass sie
sich beim Zerschlagen des Glasrohrs durch das Geschoss berühren, der
Schalter also geschlossen wird und die Entladung des Kondensators über
die Funkenstrecke erfolgt. Die Geschossbahn wird so orientiert, dass
sie senkrecht zur optischen Achse der Abbildung in der Gegenstandsebene
vor der Kondensorlinse vorbei führt. Um diese Entladung zeitgerecht zu
zünden, muss die Entfernung zwischen dem Ort des Glasrohrs und der
optischen Achse nun so gewählt werden, dass der Funke genau dann
aufleuchtet, wenn sich das Geschoss vor der Kondensorlinse befindet,
also abgebildet wird. Die Zeit, die das Geschoss für den Weg zwischen
dem Glasrohr und der optischen Achse braucht, muss also gleich der
Zündverzugszeit bis zum Auftreten des Funkens sein. Der Schieber der
Kasette, in der sich die Fotoplatte befindet, wird kurz vor dem Schuss
geöffnet. Während der Zeit, in der die Kasette offen ist, wird der
Umgebungsraum abgedunkelt.
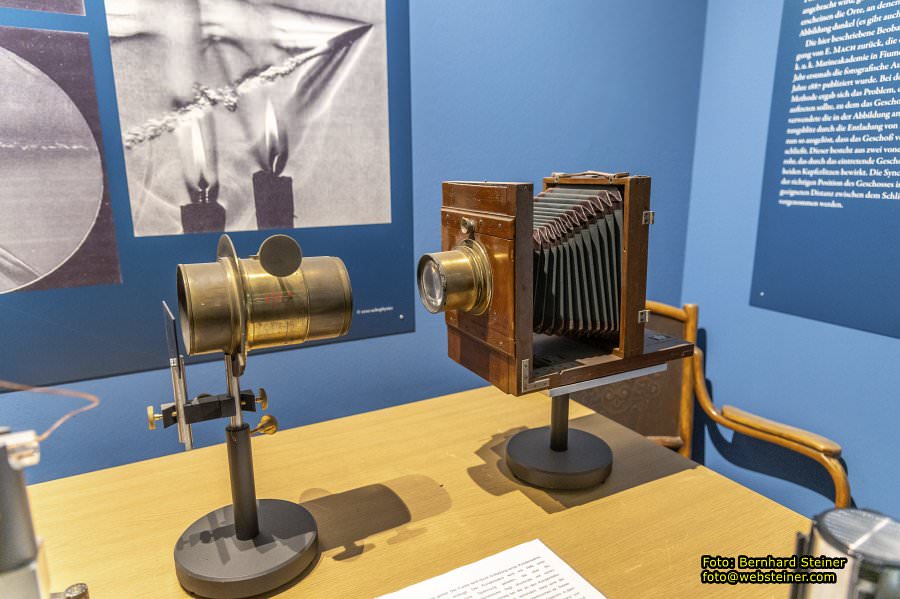
Kanalstrahlröhre, Geisslerröhe mit Uranglass, Anodenröhre mit rotem Strahl

Das Museum wurde am 29. Mai 2010 eröffnet. Die Ausstellung trägt das
Motto Strahlung – der ausgesetzte Mensch. Zu sehen sind historische
Instrumente und Versuchsanordnungen, mit denen ionisierende Strahlung
erforscht wurde. Zwei Schwerpunkte der Ausstellung sind historische
Apparate des Wiener Instituts für Radiumforschung sowie Leben und Werk
von Victor Franz Hess, Physik-Nobelpreisträger und Entdecker der
kosmischen Strahlung.

Glühlampe, 14000 Lumen, 2700 K, 240 Volt, Sockel E 40, 1000 Watt

Vom Lesestein zur Brille
Das Auge, unser wertvollstes Sinnesorgan, vermittelt uns die meisten
Erkenntnisse. Doch erwa 75% der Menschen sind fehlsichtig. Das macht
die Brille zu einem wichtigen Hilfsmittel. Sie verbessert nicht nur
unsere Lebensqualität, sondern ist ein kulturhistorisch bedeutsamer
Schritt, der die produktive Lebensphase von geistig und künstlerisch
tätigen Menschen zum Teil um Jahrzehnte verlängert. Griechische und
arabische Denker, später Praktiker in Klosterzellen prägten die erste
Geschichte der Brille. Der Lesestein, direkt auf die Schrift aufgelegt,
wurde um 1240 die Leschilfe für alterssichtige Mönche.
Die eigentliche Brille erfand man im 13. Jahrhundert in Norditalien.
Das Wort „Brille" ist von „Beryll" abgeleitet, ein Halbedelstein, der
neben Glas und Quarz als Material für Lesesteine diente. Zu Beginn gab
es nur Brillen mit Sammellinsen für alterssichtige und weitsichtige
Augen. Spätestens seit 1517 gibt es auch Zerstreuungslinsen für
kurzsichtige Augen. Die erste Bifokalbrille fertigte 1784 BENJAMIN
FRANKLIN (1706-1790). Im 17. Jahrhundert begann die wissenschaftliche
Behandlung brillenoptischer Fragen, doch erst das punktuell abbildende
Glas mit korrigiertem Astigmatismus schiefer Bündel, das MORITZ VON
ROHR (1868-1940) 1908 im Zeiss-Werk entwickelte, brachte den Durchbruch
zum mathematisch-optisch berechneten Brillenglas.
Brillenfassungen wurden zunächst aus Holz, dann aus Leder, Horn oder
Fischbein, später aus Metall und schließlich aus Azetat oder
Kunststoffen gefertigt. Ursprünglich wurde sie einfach von Hand
gehalten, in späterer Zeit auf die Nase geklemmt. Ohrenbügel, wie sie
heute üblich sind, kamen erst im 19. Jahrhundert auf. Lange diente die
Brille mehr als modisches Accessoire denn als Sehhilfe. sErst zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wurde die Brille in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung als medizinisches Hilfsmittel anerkannt, und sind spezielle
Brillen für Augen mit krankhaft herabgesetzter Sehschärfe serienmässig
hergestellt worden.

Filmkamera EUMIG C3 R
Objektiv Schneider Xenoplan 1:1,9/13 mm
Obj. Konverter Eumicron 0,5x, Sucher korr.
Obj. Konverter Eumakro 2x, Sucher korr.
Film 2x8 mm, Federwerk 8-32 Bilder/sec
Nachführ Belichtungsmesser, Bj. ca.1959

Ausziehbares Fernrohr
6 facher Auszug aus Pappe und Kleisterpapier, Leder und Holz. Repariert nach 1885.
Strahlengang mit 4 Linsen (nach Schyrle, 1645)
Aufrechtes Bild, Vergrößerung ca. 10 fach, Länge 55 cm, Ausgezogen 220 cm

Reisekamera - Klappkamera mit Balgenauszug
Plattengröße bis 13 x 18 cm, Objektiv Zeiss Protar 1:9, f = 25 cm, Baujahr cm 1900

Makro Objektiv Medical 100
Brennweite 100 mm, Öffnung 1:4, Abbildungsmaßstab 1:1 bis 1:15
Xenon Ringblitz für Schatten und Reflex freie Aufnahmen. Fa. YASHICA, Japan, ab ca. 1970

Kleinstkamera
PEDAL, St. Peter Optical Company < Made in occupied Japan > 1945
Detektivkamera, Objektiv f = 12mm 1:5,6, Verschluß: B - Offen, I - Moment, Film 25 mm Ø, 6 Bilder zu je 6mm Ø

Bolex H16 Reflex

Gefahren von weichen Strahlen - Mikrowellen, Radiowellen, Radar und Infrarot
Jeder Mensch ist täglich weicher Strahlung, z. B. Radiowellen, die
Handys, Handymasten und Radio- und Fernsehstationen ausgesetzt. Diese
allgegenwärtige Strahlung übt zweifelsfrei einen Einfluss auf den
Menschen aus. Fraglich ist, wie groß dieser Effekt ist.
Schädigen Handys das Gehirn?
DAS HANDY IST GEFÄHRLICHER ALS DER HANDYMAST. Obwohl Handymasten
weitaus mehr Energie abstrahlen, sind sie ungefährlicher als die Handys
selbst, da sie horizontal gerichtet und weit über Kopfhöhe abstrahlen.
Da sich das Handy in unmittelbarer Körpernähe befindet, stellt es die
größere Gefahrenquelle dar. Bislang konnte jedoch keine Studie
nachweisen, dass Handystrahlung langfristig gesundheitliche Schäden
hervorruft - auch, weil es Mobilnetze noch nicht lange genug gibt.
WIE SCHÜTZT MAN SICH GEGEN WEICHE STRAHLUNG? Die weichen Strahlen
werden vom menschlichen Körper absorbiert und erwärmen das
wasserhaltige Gewebe. Gut durchblutete Organe führen diese Wärme über
die Blutzirkulation ab. Gefährdet sind hingegen wenig durchblutete
Organe, wie der Glaskörper des Auges, in denen die Hitze größtenteils
gespeichert wird. Da die Abstrahlung weicher Strahlen bereits nach
wenigen Metern auf ein Tausendstel abfällt, schützt man sich am besten
durch ausreichende Distanz zur Strahlungsquelle. Mit Head-Sets oder
Freisprecheinrichtungen kann man sich also vor Handystrahlung schützen.
Die Gefahr des Sonnenlichtes
Die im Sonnenlicht vorhandene (unsichtbare) Ultraviolett-Strahlung
bildet die Grenze zwischen weicher und harter Strahlung. Zusätzlich zu
Erwärmungseffekten kann UV-Strahlung photochemische Reaktionen auslösen
und zur Schädigung von Haut und Augen führen. Zur Bewertung der Wirkung
von UV-Strahlung dient der UV-Index (UVI), der häufig in
Wettervorhersagen genannt wird und die sonnenbrandwirksame solare
Bestrahlungsstärke angibt.
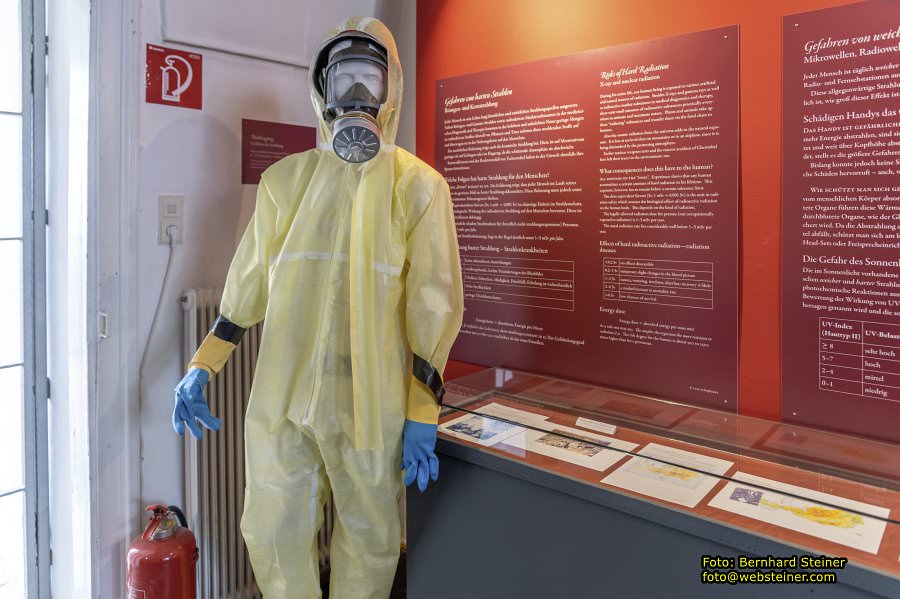
Der Schlosspark in Pöllau, im Hintergrund St. Veit

Der Schlosspark Pöllau war einst der Erholungsraum der Augustiner
Chorherren. Der blühende und grüne Schlosspark bietet viel Platz zum
Entspannen und ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Hier
befindet sich auch das Freiluftklassenzimmer, die Info-Station
Hirschbirn hirsch’n sowie eine Wurzelschaustation, an der man im Rahmen
einer Führung in die eindrucksvolle Welt des Pflanzenorgans „Wurzel“
eintauchen kann.

Auch heute noch lädt der Schlosspark zum Entspannen ein – fast das
ganze Jahr blühen hier die Blumen; der Gastgarten des Parkcafés mit dem
Kinderspielplatz ist hervorragend für ein gemütliches Verweilen
geeignet.

Einst als Erholungsraum der Augustiner Chorherren, diente der
Schlosspark im Naturpark Pöllauer Tal zur Entspannung und bot Platz für
allerlei Freizeitbeschäftigungen. Heute lädt der rund 40.000 m2 große
Schlosspark nach wie vor zum Entspannen ein und ist Ausgangspunkt für
Wanderungen im Naturpark. Fast das ganze Jahr blühen hier die Blumen
und der Kinderspielplatz gleich beim Gastgarten des Parkcafes ist
hervorragend für gemütliche Nachmittage geeignet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: